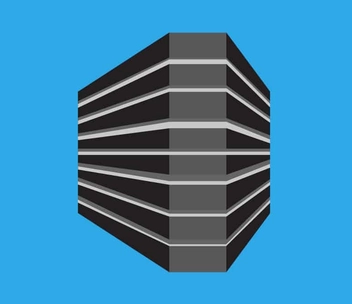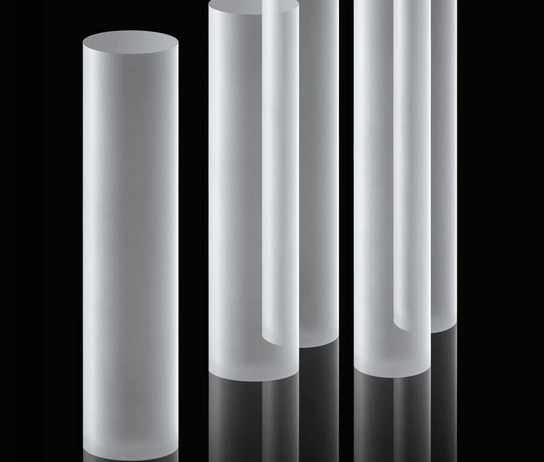Wissen
Wie funktioniert eine mechanische Uhr? Wie wird sie hergestellt und von wem? Unsere Wissensartikel führen in die Welt hinter dem Zifferblatt und bieten Hintergrundinformationen – zur Funktionsweise der Mechanik ebenso wie zu den namhaften Uhrenmanufakturen und der Arbeit des Uhrmachers.